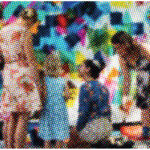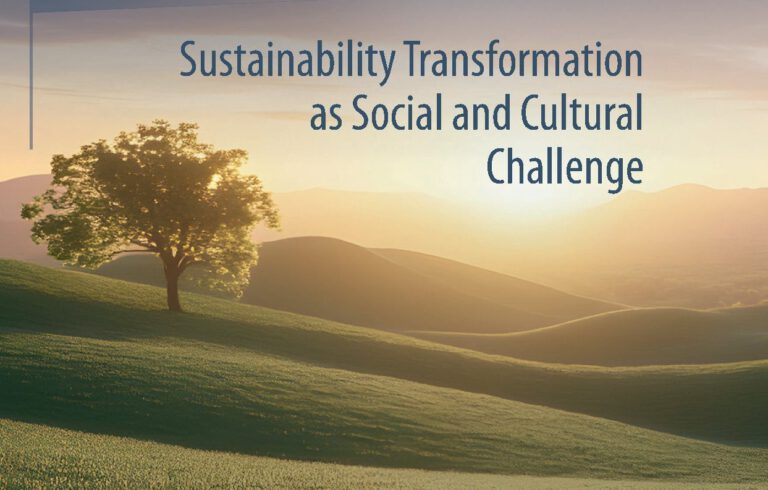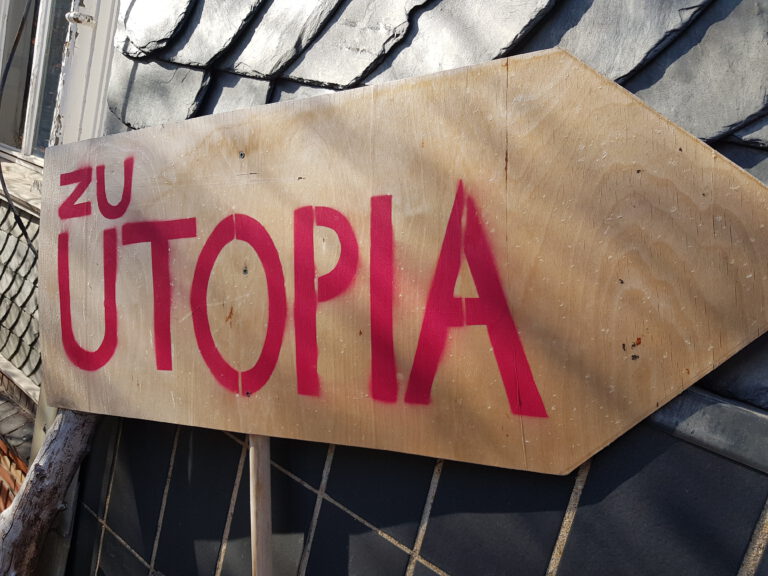Im Zeitalter der Polykrise rückt die Frage nach den sozialen und kulturellen Faktoren, die die Resilienz von Gesellschaften stärken, immer stärker in den Fokus. Genau dazu stellte mir Lea Lükemeier von der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein einige Fragen …
Was verstehen Sie unter sozialer Resilienz?
Der Begriff der Resilienz stammt ursprünglich aus der Medizin und Psychologie. Menschen reagieren nicht immer gleich auf Krankheiten oder Traumata: Was bei dem einen zum Tod führt, stärkt bei einem anderen die Antikörper. Das bedeutet, dass manche Menschen verletzlicher und andere widerstandsfähiger sind. Dieser Begriff wurde auf ökologische und soziale Systeme übertragen.
Bei ökologischen und sozialen Systemen ist eine präventive Resilienz wichtiger als eine reaktive: Dies gilt sowohl für den Klimawandel als auch für Finanzkrisen und Kriege. Die Ursachen von Krisen zu behandeln, ist nachhaltiger, als nur die Symptome zu lindern. Wenn der Status quo selbst die Ursache für Krisen ist, dann braucht die Resilienz nicht seinen Schutz, sondern seine Veränderung.
Vielfalt macht ökologische und soziale Systeme in Krisenzeiten agiler. Wälder mit hoher Biodiversität sind widerstandsfähiger gegen den Klimawandel als Baum-Monokulturen. Städte mit Subkulturen und Nischen, in denen Alternativen gedeihen können, sind ebenfalls besser für die Zukunft gerüstet. Während eine plurale Wirtschaft resilienter ist, ist eine neoliberale Monokultur krisengefährdet, wie die Finanzkrise von 2008 gezeigt hat. Monokulturen, einschließlich mentaler, weisen eine erhöhte Vulnerabilität auf, weil sie dazu tendieren, die Ursachen von Problemen als Lösungen zu verpacken. Ein Beispiel dafür sind Wirtschaftswachstum und technologische Innovation: Diese werden immer noch als Allheilmittel betrachtet, obwohl sie viele Probleme verursacht haben.
Ein weiterer wichtiger Faktor der Resilienz ist Autonomie, also die Möglichkeit der Selbstorganisation. Polyzentrische Netzwerke sind in der Regel flexibler und widerstandsfähiger als zentralistische Organisationen. Das Gegenteil von Autonomie sind Abhängigkeiten. Eine Gesellschaft mit hohem Energie- und Ressourcenverbrauch ist in Anbetracht der planetaren Wachstumsgrenzen verletzlicher. Fahrradfreundliche Städte hingegen sind widerstandsfähiger gegen steigende Ölpreise und tragen weniger zum Klimawandel bei. Regionen mit einer Parallelwährung sind widerstandsfähiger gegenüber internationalen Finanzkrisen, weil ihre Wirtschaft auch dann weiter funktionieren kann, wenn Euro oder Dollar nicht fließen.
Soziale Resilienz hängt auch stark mit sozialer Kohäsion zusammen. Bäume sind widerstandsfähiger, wenn sie in der Nähe anderer Bäume wachsen und über ihre Wurzeln Netzwerke bilden können. Dasselbe gilt für Menschen: Sie sind Individuen und soziale Wesen zugleich. Soziale Netzwerke können Autonomie mit Bindung sowie Vielfalt mit Einheit verbinden. In schwierigen Zeiten sind sie fundamental für das Überleben von Individuen. So konnte Barcelona die Finanzkrise von 2008 leichter überwinden, weil dort die Nachbarschaften relativ stark sind. Menschen, die ihre Arbeit verloren hatten, begannen miteinander zu teilen und eine Tauschwirtschaft aufzubauen. Wenn soziale Kohäsion und Vertrauen Systeme widerstandsfähiger und flexibler machen, dann machen soziale Ungleichheit und Misstrauen sie anfälliger und rigider.
Welche Relevanz hat soziale Resilienz heute?
Heute stehen wir zwischen zwei großen Transformationen. Die dominante ist die kapitalistisch-industrielle Transformation, die vor einigen Jahrhunderten begann. Die neoliberale Globalisierung war ihr Höhepunkt und ist wahrscheinlich der Todesstoß für dieses Entwicklungsmodell. Dies hat die Resilienz geschwächt und die Verwundbarkeit erhöht. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die gemeinsam mit dem US-Präsidenten Ronald Reagan in den 1980er-Jahren die neoliberale Wende einleitete, sagte 1987 in einem Interview: »Es gibt keine Gesellschaft, sondern nur Individuen«. Wenn es aber keine Gesellschaft gibt, dann existieren nur private Probleme, die individuell gelöst werden müssen. In der neoliberalen Gesellschaft ist jeder für sich selbst verantwortlich – für den eigenen Erfolg oder für den eigenen Misserfolg. Diese Denkweise führte zum Abbau des Wohlfahrtsstaates und zu einem verbreiteten Gefühl der Unsicherheit. In den letzten Jahrzehnten lernten wir, miteinander zu konkurrieren, um einen der wenigen Plätze in der Sonne zu ergattern. Bekanntlich legitimierte Margaret Thatcher ihre Politik vor allem mit dem Satz »there is no alternative«. Diese Rhetorik der Alternativlosigkeit fand nach ihr zahlreiche Nachahmerinnen und Nachahmer. Wenn es keine Alternative gibt, bleibt nur die Monokultur. Die Gesellschaft verkommt zu einer »Megamaschine«, und Politik zu einer »Verwaltung von Sachen«. Auf Störungen und Krisen wird mit einer Stabilitätsstrategie reagiert – durch Reparaturen, Optimierungen und die Verlagerung von Kosten. Der Fokus liegt auf der Funktionsfähigkeit der Maschine, während verdrängt wird, dass selbst eine perfekt funktionierende Maschine gegen die Wand fahren kann. Vor diesem Hintergrund braucht Nachhaltigkeit nicht besser funktionierende Menschen, sondern zunächst deren Emanzipation von der Megamaschine.
Hier geht es mit dem Interview weiter…
© Dr. Davide Brocchi, 24.8.2025