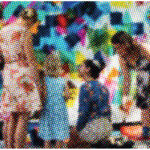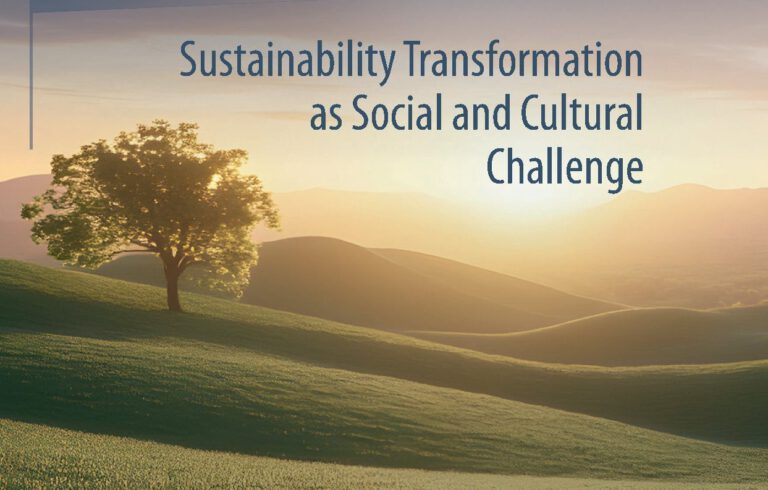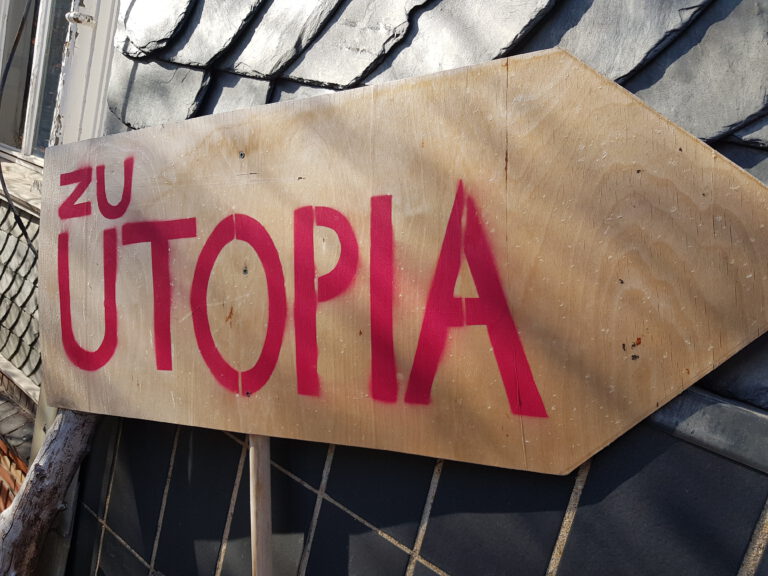Auszug aus meinem Beitrag im neuen Sammelband Klimawende jetzt von Hermann Theisen, der beim oekom Verlag erschienen ist.
Obwohl seit dem ersten Bericht des Club of Rome bereits mehr als 50 Jahre vergangen sind, klaffen das Versprechen der Nachhaltigkeit und die tatsächlichen Entwicklungen immer weiter auseinander. Die größte Herausforderung liegt heute nicht in der Lösung, sondern im Loslassen des Problems. Dies gilt auch für den Klimawandel.
Begriffe wie Klimawandel oder Klimaschutz erzeugen ein Framing, das den Fokus auf das Symptom legt, während die Ursachen in den Hintergrund rücken. Solange diese unbehandelt bleiben, kann sich das Problem nur weiter verschärfen. Dementsprechend ersetzt die Dringlichkeit der Klimaanpassung zunehmend jene des Klimaschutzes. So werden die Dämme gegen die Überschwemmungsgefahr erhöht und Klimaanlagen immer häufiger eingesetzt, während Kohle, Öl und Gas weiter verheizt werden. Selbst in Deutschland wird 77,4 % des Primärenergieverbrauchs immer noch durch fossile Energieträger gedeckt (UBA 2024). Gleichzeitig versprechen technologische Innovationen und Marktinstrumente wie der Emissionsrechtehandel eine Problemlösung ohne strukturelle Ursachenbehandlung. Daran orientiert sich auch die Bundesregierung, die gegen den Klimawandel noch »mehr Fortschritt wagen« (SPD/Grüne/FDP 2021) will: mehr Windräder, mehr Elektroautos, mehr Digitalisierung usw. Im Programm der Ampelkoalition kommt das Wort »weniger« lediglich zwei Mal vor. Wenn Nachhaltigkeit nur Zusatz sein darf, dann werden Umweltprobleme meistens verschärft oder verlagert. Für ihre Lösung ist »Exnovation« jedoch entscheidender als Innovation.
Die Überwindung der Klimakrise wird durch die Tatsache erschwert, dass sie nur eine von vielen Krisen ist, mit denen unsere Gesellschaft gegenwärtig zu kämpfen hat. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise oder des Krieges hat es der Klimaschutz besonders schwer. Dabei wird oft übersehen, dass die heutigen Krisen ineinander verwoben sind, sich wechselseitig nähren und gemeinsame Ursachen haben. Dementsprechend sollte die Polykrise (Morin und Kern 1999) – und nicht nur die Klimakrise – der Gegenstand der Nachhaltigkeits- und Transformationsdebatte sein. Die gegenwärtige Polykrise ist weder eine unerwartete Naturkatastrophe noch Ausdruck eines bösen Schicksals, sondern das Resultat einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung und von bewussten Entscheidungen. Selbst wenn die »Große Transformation« heute gerne als »Zukunftsaufgabe« begriffen wird (Sachs 2013), sind wir tatsächlich immer noch in der alten kapitalistisch-industriellen Transformation gefangen. Damit setzte sich bereits der Sozialanthropologe Karl Polanyi (1886 – 1964) auseinander. In seinem Werk »The Great Transformation« von 1944 warnte er vor der »krassen Utopie« von Märkten, die sich selbst regulieren können. Wer die Marktkräfte entfessele, müsse mit der Vernichtung der menschlichen und natürlichen Substanz der Gesellschaft rechnen, so Polanyi. Er hatte diese Entwicklung selbst erlebt: Von der Liberalisierung der Märkte zur Weltfinanzkrise von 1929, dann die sozialen Polarisierungen, die autoritären Entwicklungen und schließlich der Krieg. Dass sich diese Verkettung von Phänomenen in den letzten Jahrzehnten wiederholt hat, zeigt, dass sich unsere Gesellschaft in ihren tiefliegenden Strukturen kaum gewandelt hat […].
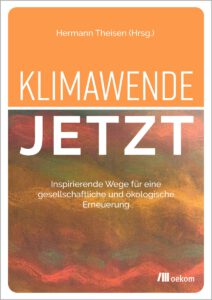 Aus: Davide Brocchi (2025), Die Kultur ändern, in der wir erzogen wurden. In: Hermann Theisen (Hrsg.), Klimawende jetzt. München: oekom (S. 26-30)
Aus: Davide Brocchi (2025), Die Kultur ändern, in der wir erzogen wurden. In: Hermann Theisen (Hrsg.), Klimawende jetzt. München: oekom (S. 26-30)