Hinter dem Konzept »Tag des guten Lebens« steckt auch eine persönliche Geschichte. Es ist die Erfahrung der letzten 40-50 Jahre, die mich zu bestimmten Transformationsansätzen geführt hat. Diese Hintergründe habe ich im Prolog zum Buch »Urbane Transformation. Zum guten Leben in der eigenen Stadt« (2017) dargestellt. Hier der Text.
Prolog zum Buch »Urbane Transformation« (2017)
»Der Klimawandel ruft nach einem Zivilisationswandel«, schreibt der Soziologe Wolfgang Sachs (B.U.N.D./EED/Brot für die Welt 2008: 25) und Ernst Ulrich von Weizsäcker beginnt das Buch »Faktor Fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum« (Weizsäcker et al. 2010) mit den Worten: »Großer Wandel steht uns bevor. Noch nie stand die Menschheit, standen wir vor einer so überwältigenden Aufgabe«. In diesem Sinne fordert auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) einen neuen »Gesellschaftsvertrag für die Große Transformation«.[1] Transformation ist zum zentralen Thema der Nachhaltigkeitsdebatte aufgestiegen, ohne dabei jedoch eine neue Erfindung zu sein, denn Transformation begleitet die Menschheit schon seit ihrer Entstehung, jenseits von »Revolutionen« wie der Neolithischen oder der Industriellen.
In meiner Kindheit saß die Transformation mit den drei Generationen unserer Familie täglich an einem Esstisch. Meine Großeltern hatten die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts unmittelbar erlebt, blieben ein Leben lang davon geprägt und hörten nie auf, uns Kindern eines zu wünschen: Dass uns die Erfahrung des Kriegs erspart bleibe, denn »Krieg ist das schlimmste überhaupt« – und doch menschengemacht. Auf dem italienischen Land betrieben sie als Kleinbauern eine Form von Subsistenzwirtschaft, wobei der Nahrungsbedarf der ganzen Familie zum großen Teil durch Eigenproduktion gedeckt wurde. Für sie waren der Obst- und Gemüseanbau, die Verarbeitung des Fleisches zu unzähligen Wurstsorten sowie das Kochen mehr als Arbeit: Es war eine Leidenschaft, in gewisser Weise eine Kunst. Ihre Gäste begrüßten sie stets mit dem besten Wein aus dem Haus, ein genussvolles Lob galt ihnen als höchster Lohn. Nach heutigen Maßstäben würden meine Großeltern wahrscheinlich zum »bildungsfernen Milieu« zählen – und doch verfügten sie über ein unschätzbares Wissen sowie über ein breites Spektrum an handwerklichen Fähigkeiten, die von Generation zu Generation übertragen wurden. Sie kannten das Wort »bio« nicht und doch war ein chemiefreier Anbau für sie das normalste überhaupt gewesen. Mein Vater erinnert sich noch heute daran, wie die Gemüse- und Obsternten in den 1950ern nicht unbedingt schlechter als heute ausfielen, »obwohl darauf nichts gespritzt wurde«.[2] Seine Erklärung: »Wahrscheinlich lag es an der höheren Biodiversität, wobei Parasiten von natürlichen Feinden bekämpft wurden. Hinzu kommt, dass die Fruchtbäume fast Wildpflanzen waren und keiner künstlichen Selektion wie heute unterlagen«.
Unsere Familie gehörte der Unterschicht an und hatte im Krieg erlebt, wie das Zusammenbrechen eines Versorgungssystems das Verhältnis zwischen Stadt und Land bzw. zwischen Bürgertum und Bauerntum radikal umkehren kann. 1944 waren die Menschen aus den bombardierten Städten in die ländliche Umgebung geflohen, dort wo meine Großeltern lebten. Elend sahen sie aus und ob sie früher angesehene Professoren, Beamte oder erfolgreiche Geschäftsleute gewesen waren, spielte gar keine Rolle mehr. Manche wüteten auf den Ackerfeldern wie hungrige Tiere und gruben mit den bloßen Händen im Schlamm nach Kartoffeln. In Zeiten schwerer Krisen stehen die Kleinbauern am besten da, weil die Hacke und die Erde es sind, die letztendlich die Existenz sichern.
Geld gab es bei uns zu Hause immer wenig, und man brauchte eigentlich auch nicht so viel davon. Vieles wurde selbst gemacht, repariert und wiederverwertet, vor allem aber geteilt. Man teilte in der Verwandtschaft und in der Nachbarschaft, Wissen, Werkzeuge und oft das Essen selbst. Man half sich gegenseitig, egal ob es um die Ernte oder das Bauen eines neuen Zuhauses ging. Man schenkte sich viel und pflegte so ein dichtes soziales Netzwerk, das einen nie fallen ließ – zumindest so lange man sich an gewisse Regeln hielt. In seinem Leben konnte mein Großvater Giuseppe nie einen hohen sozialen Status erringen und doch folgte 1982 eine außergewöhnlich lange Prozession seinem Sarg: Fast alle Dorfbewohner kamen, um ihm den letzten Gruß zu geben. Wer darf in Zeiten von Facebook noch mit solch einer Anteilnahme nach seinem Tod rechnen?
Mein Vater und meine Mutter träumten hingegen von der Emanzipation – und diese war vorerst eine höchst private Angelegenheit. Die Verwandtschaft und die Nachbarschaft boten zwar eine hohe soziale Sicherheit, die Kehrseite davon war jedoch ein hohes Maß an sozialer Kontrolle. Eine Lebensplanung, die von den Erwartungen abwich oder ein Verhalten, das der Norm widersprach, wurde mit einer schleichenden Ausgrenzung bestraft. Jeder kannte die verheerenden Effekte der Gerüchteküche, die im Dorf aufbrodelte, sobald sich eine Mutter scheiden ließ oder ein Mann auffällig feminine Manieren zeigte. Der Umgang mit »Devianten« war jedoch symptomatisch für die Tatsache, dass eine echte individuelle Selbstentfaltung schon innerhalb der Familie gehemmt statt gefördert wurde. Meine Mutter berichtete mir zum Beispiel von den harten Auseinandersetzungen, die sie als junges Mädchen mit ihrem Vater gehabt hatte, nur weil sie eine Hose statt eines langen Rocks in der Öffentlichkeit tragen wollte. Als sie zwanzigjährig meinen Vater heiratete und Teil seiner Großfamilie wurde, weigerte sie sich, den Lohn ihrer Arbeit in die Familienkasse einzuzahlen und sich den Schwiegereltern unterzuordnen. Die harten Konflikte, die daraus folgten, brachten meine Eltern irgendwann dazu, die patriarchalische Großfamilie zu verlassen und eine eigene Wohnung mitten im Dorf zu beziehen – als moderne Kleinfamilie.
Die Emanzipation betraf aber nicht nur das Verhältnis zwischen den Generationen, sondern auch das zwischen den Geschlechtern. Meine Mutter wollte nicht die brave Hausfrau sein, die sich am Herd verwirklicht, während der Mann abends das öffentliche Leben in den Gaststätten pflegt. Sie hatte nur die Grundschule abschließen dürfen und wusste, wie wichtig Bildung für die Emanzipation ist. So entschied sie, eine Abendschule zu besuchen, um den Mittleren Schulabschluss zu erlangen. Doch anstatt sie dabei zu unterstützen, reagierte mein Vater fast panisch und fürchtete um seine Kontrolle. Sie blieb bei ihrer Entscheidung. Damals wurde mir bewusst, wie intim sozialer Wandel, wie politisch Gefühle und Emotionen sein können.
Transformation verläuft selten konfliktfrei, im Gegenteil braucht sie manchmal gerade den Konflikt, die Offenlegung des Widerspruchs, um sich entfalten zu können. Wer den Konflikt lieber hemmt, nur um den Schein der bestehenden Ordnung, von idealisierten Familienbildern oder harmonischen Gesellschaftsentwürfen aufrechtzuerhalten, der hemmt nicht nur die Möglichkeit der Transformation als einen dauerhaften Lernprozesses, sondern zwingt den Mitmenschen und gewissermaßen auch der eigenen inneren Vielfalt seine eigene Logik auf. Emanzipation meint auch die Befreiung des Selbst von einer Moral und der Beziehung von einer Doppelmoral. Transformation lernen heißt, Beziehungsformen zu entwickeln und zu praktizieren, die Lebendigkeit, Menschlichkeit und Authentizität vertragen statt diese zu bekämpfen. Transformation lernen heißt, den Umgang mit dem Konflikt, dem Widerspruch und der Andersartigkeit zu lernen.
Mein Vater, die Onkel und die Tanten nahmen Emanzipation vor allem als politische Angelegenheit wahr, in den 1970ern waren sie politisch äußerst engagiert. Diese Generation war nicht mehr bereit, die strukturelle Benachteiligung zu akzeptieren, zu der ein großer Teil der Gesellschaft, unsere Familie inbegriffen, seit Generationen verdammt war. Kein festliches Essen mit Verwandten endete in meiner Familie ohne eine leidenschaftliche, oft laute und kontroverse Diskussion über Politik – und zwar obwohl alle Anwesenden sonntags zum Gottesdienst gingen und gleichzeitig Mitglieder derselben Partei waren, der Partito Comunista Italiano (PCI).[3] Der politische Kampf um mehr Gerechtigkeit musste jedoch im Kalten Krieg fast ohne Folgen bleiben, denn Italien wurde eine echte Demokratie verwehrt, genauso wie vielen anderen Ländern. Die Erinnerungen an die Gräuel des letzten Kriegs waren noch lebendig – und zugleich war die Angst vor einem neuen, noch schlimmeren, wahrscheinlich endgültigen Krieg damals allgegenwärtig. Einmal nahm mich mein Vater zu einem öffentlichen Vortrag nach Rimini mit, in dem ein Experte erklärte, welche verheerenden Konsequenzen die Explosion einer Kernwaffe mit einem Atomsprengkopf von einer Megatonne über unserer Region gehabt hätte. Auf der Wand projizierte er die entsprechende Landkarte mit mehreren konzentrischen Kreisen. Der mittlere Punkt stellte das mögliche Explosionszentrum einer sowjetischen SS-20 dar: Die NATO-Militärbasis von Miramare, auf der damals US-Bomber mit Atomwaffen stationiert waren, in ständiger Alarmbereitschaft. In einem Umkreis von sechs Kilometern wäre die Zerstörung vollständig, fast ohne Überlebenschance für die Bevölkerung gewesen – so der Experte. Unser Dorf lag innerhalb des 15 Kilometer-Kreises, hier wäre draußen mit Verbrennungen mindestens zweites Grades zu rechnen gewesen, dazu mit einer weitgehenden Verstrahlung des Gebiets. Mit solchen Vorstellungen mussten wir uns damals auseinandersetzen. Diejenigen, die Geld hatten, befreiten sich von diesen Ängsten durch den Bau eines Atombunkers im eigenen Garten. Mein Vater ging lieber zu Friedensdemos und nahm mich auch zu der größten mit: am 22. Oktober 1983 in Rom, als fast eine Million Menschen auf die Straße gingen. Gemeinsam bekämpften sie das Gefühl der Ohnmacht, das Gefühl, dass die eigene Existenz zwei Weltmächten völlig ausgeliefert sei.
Und dann ging der Kalte Krieg plötzlich und unerwartet zu Ende. Nicht die Waffen und die Gewalt brachten diesmal die entscheidende Wende, sondern eine kulturelle Revolution: die der Perestroika und der Glasnost in der Sowjetunion. 1989 löste große Hoffnungen in der Weltgesellschaft aus. Der Auflösung des Warschauer Paktes im Jahr 1991 hätte die der NATO folgen können. Im »gemeinsamen Haus Europa« (Gorbatschow 1987) hätten Ost und West dauerhaft friedlich leben und ihre Atomarsenale komplett abrüsten können. In Polen, Ungarn und Rumänien wurde die Demokratie eingeführt, während in Italien das korrupte politische System, das fast 50 Jahre lang jedem erdenklichen Skandal standgehalten hatte, plötzlich wie ein Luftschloss zusammenbrach. Die unglaubliche Masse an Ressourcen und Finanzmitteln, die jahrzehntelang dem Wettrüsten geopfert worden waren, hätten nun in den sozial-ökologischen Umbau der Weltgesellschaft einfließen können – das war die eigentliche Vision hinter dem Erdgipfel, der 1992 in Rio de Janeiro stattfand und der die Agenda 21 verabschiedete. All diese Erwartungen wurden jedoch bald enttäuscht.
Die »Große Transformation« in Richtung Nachhaltigkeit war damals so greifbar nah, wie konnte sie scheitern? In welcher Form kann sie nun doch noch gelingen? Mit solchen Fragen muss sie sich nun meine Generation auseinandersetzen, denn für unsere Kinder könnte es sonst zu spät sein. In diesem Buch befasse ich mich vor allem mit der zweiten Frage und vertrete die These, dass eine umfassende Transformation in Richtung Nachhaltigkeit vor allem von unten, partizipativ vorangetrieben werden kann. Der erste Schritt liegt in der Rückeroberung lokaler Räume durch die Bürger/innen. Sie können die eigene Straße, das eigene Viertel und die eigene Stadt zum Gemeingut machen und gemeinsam gestalten bzw. selbst verwalten. Bei einem Realexperiment in Köln wurde dieser Ansatz praktiziert, in diesem Buch berichte ich über die wichtigsten Erkenntnisse und Lehren, die daraus entstanden sind. Wenn dieser Transformationsansatz auch nicht ganz neu ist, so bin ich durch meine persönlichen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und durch Reflektionen über die gesellschaftlichen Entwicklungen auch selbst zu dieser Überzeugung gekommen. Einige davon werde ich im Folgenden skizieren.
Erstens. Von der Lebensweise meiner Großeltern werden heute viele Aspekte paradoxerweise als Bestandteil »neuer« Wohlstandmodelle wiederentdeckt und aufgewertet, nachdem sie in den letzten Jahrzehnten dem Modernisierungsprozess geopfert wurden. So wie die Smartphones wenige Jahre nach ihrer Einführung wie selbstverständlich zu unserem Alltag gehören, so wurde damals die Chemie den Kleinbauern erst schmackhaft gemacht und dann von ihnen, meine Großeltern inbegriffen, nach und nach angenommen, bis sie Normalität wurde. Naiv folgten die Menschen dem Versprechen der Chemieindustrie: Je mehr Pestizide und Kunstdünger verwendet werden, desto besser die Ernte und leuchtender die Äpfel. Die Nebenwirkungen dieses groß angelegten Experiments zeigten sich jedoch schon wenige Jahre später: In den 1970ern stiegen die Krebsraten in unserer Region rasant, während Unmengen an Düngemitteln in die Adria flossen und dort immer öfter zu extremen Algenplagen führten. Erst als die Touristen fernblieben und die mächtige Lobby der Hotelbesitzer hohe Verluste meldete, griff die Politik ein.
Trotz solcher Erfahrungen werden die Industrialisierung und Modernisierung heute auch in meiner Familie nicht mehr grundsätzlich infrage gestellt, sondern als »unumkehrbares Schicksal« hingenommen. Mein Vater, der inzwischen das Ackerstück seiner Eltern übernommen hat und damit immer noch den Nahrungsmittelbedarf der Familie deckt, versucht heute zwar den Einsatz von Chemie begrenzt zu halten, ganz darauf verzichten kann er aber nicht mehr: »Eine Schädlingsplage würde folgen, in solch einer extremen Form, wie wir es damals nie erlebt haben. Die Biodiversität ist zerstört worden, alles ist jetzt durcheinander und die Parasiten haben keine natürlichen Feinde mehr.« Die Landwirte sind nun von denselben Technologien abhängig, die das Problem einst verursachten. Dies dient vielleicht der Chemieindustrie und dem Bruttoinlandsprodukt, ist es aber wirklich ein Fortschritt?
In den 1980ern sah ich mit eigenen Augen was passiert, wenn sich eine Region industrialisiert. Das Wasser des Flusses, in dem meine Großeltern früher gebadet hatten, war plötzlich rot, gelb, mit Schaum bedeckt. Die Betriebe ließen ihre Abwässer einfach in die freie Natur ab, in Italien wie in Deutschland, wo der Rhein »die Kloake Europas« genannt wurde. Der Massenkonsum wurde stark gefördert, doch eine Infrastruktur für die Entsorgung des Massenabfalls, die hier mithalten konnte, fehlte noch, so dass es fast normal war, Schutt, alte Waschmaschinen und Matratzen an Flussufern zu entsorgen und natürliche Landschaften in Müllhalden umzuwandeln. Solche Bilder brachten mich 1984 mit ein paar Freunden dazu, die erste ökologische Gruppe der Gemeinde zu gründen. Als »Gruppo Ecologico Villa Verucchio« (GEW) sammelten wir jede Woche frei herumliegenden Müll und finanzierten uns durch das Sammeln und den Verkauf von Altpapier. Nach dem Super-GAU von Tschernobyl wurden wir Teil der italienischen Antiatombewegung, und auch wir sammelten in unserer Gemeinde Unterschriften für ein Referendum über den Automausstieg. Im November 1987 stimmten 80 Prozent der Italiener dafür. Auch wenn die Modernisierung inzwischen ökologische Korrekturen erfahren hat und die Luft über dem Ruhrgebiet sauberer ist, so kann von einem wirklichen Erfolg der Umweltbewegung jedoch keine Rede sein – wofür die Zementifizierung ganzer Küstenregionen (Riminizzazione, Riminisierung heißt dies inzwischen in Italien) oder das Voranschreiten des Klimawandels nur zwei Belege unter vielen darstellen. Woran liegt das?
Obwohl der Schutz der Umwelt eine genauso existentielle Frage darstellt wie die Sicherung des Friedens, sind die Umwelt- und die Friedensbewegung in ihrer bisherigen Form der modernen Logik der Spezialisierung zum Opfer gefallen. Ihre Belange werden mehr oder weniger als Spartenproblem wahrgenommen, entsprechend in Grenzen hält sich der Zulauf. In den Institutionen finden Umweltorganisationen eher schwache Behörden als Ansprechpartner (z. B. Umweltministerium, Umweltamt). Auch leiden die Diskurse und Gruppendynamiken innerhalb der neuen sozialen Bewegungen oft unter Selbstrefentialität.
Systemische Probleme benötigen jedoch eine systemische Betrachtung, also eine systemische Bewegung. Die Transformation hat erst dann eine Chance, wenn eine nachhaltige Verkehrspolitik nicht mehr durch »autofreie Sonntage« gefördert wird, während der nachbarschaftliche Zusammenhalt an anderen Tagen des Jahres mit Straßenfesten unterstützt wird, sondern wenn beides als Bestandteil einer Kultur und Lebensweise verstanden und in einen umfassenden Kontext dargestellt wird. Eine systemische Bewegung hat keinen Universalanspruch, sondern vernetzt die Vielfalt und ermöglicht ihre Entfaltung. Sie spricht Akademiker und Kleinbauern gleichermaßen an, zum Beispiel durch eine möglichst inklusive statt exklusive Sprache (z. B. gutes Leben statt Nachhaltigkeit). Jedoch ist das gesprochene Wort nicht immer der beste Weg, um Komplexität zu begreifen oder um Einheit in der Vielfalt zu fördern, denn Gefühle können, wenn sie zum Ausdruck kommen, mehr als tausend Worte sagen. Eine systemische Bewegung ist im Lokalen eingebettet, weil der gemeinsame Raum eine Identifikationskraft bildet und überschaubare Räume und Gemeinschaften eher dem »menschlichen Maß« entsprechen. Die Komplexitätssteigerung, die der systemische Ansatz mit sich bringt, wird durch die Begrenzung des Wirkungsraums ausgeglichen, um so handlungsfähig zu bleiben und Überforderung zu vermeiden.
Nach meinen ersten Erfahrungen in der Umweltbewegung entschied ich mich 1989 für das Studium der Philosophie in Bologna. Dies erschien mir damals als der beste Weg, um mich nicht zu spezialisieren und die Wirklichkeit ganzheitlich zu betrachten. Ich wollte die Zusammenhänge verstehen und damit dem ersten Gesetz der Ökologie gerecht werden: »]edes Ding steht mit jedem anderen in Beziehung« (Commoner 1973: 38). Das Studium konnte aber meine Erwartungen nicht ganz erfüllen, ich brauchte eine irdischere Perspektive und wechselte nach zwei Jahren zu den Politik- und Sozialwissenschaften. In den Vorlesungen über Kant, den Vorträgen von Professor Umberto Eco über Semiotik sowie der Beschäftigung mit der Kulturanthropologie hatte ich jedoch gelernt, wie wichtig Kultur ist. Jede gesellschaftliche Transformation ist gleichzeitig eine kulturelle und sollte als solche verstanden werden. Kultur und Natur sind keine Gegensätze: Die Kultur meiner Großeltern war für Jahrhunderte Teil eines ökologischen Gleichgewichts; die Zerstörung lokaler Kulturen ist in der Geschichte Hand in Hand mit der Zerstörung der Biodiversität gegangen. Die Modernisierung negiert diese Zusammenhänge und materialisiert ein Separationsdenken, das Natur und Geist, Natürliches und Künstliches, Alt und Neu oder Tradition und Moderne nicht nur getrennt, sondern auch hierarchisch behandelt.
Wenn ich heute meine Eltern in Italien besuche, finde ich fast nichts mehr, was mich an das alte Dorf erinnert: Die Modernisierung hat sich dort vergegenständlicht, durch das Ersetzen der alten Bauernhäuser mitten im Dorf durch eine standardisierte, mal kitschige, mal sterile Architektur, die austauschbar ist und mit der Region nichts zu tun hat. Dadurch verliert der Raum seine Fähigkeit, emotionale Identifikation und dadurch Gemeinschaft zu stiften. Als Kind hörte ich zuhause und in der Nachbarschaft nur Dialekt. Schon die Verwendung dieser lokalen Sprache förderte ein einzigartiges Gefühl der Zugehörigkeit. Heute stirbt der »dialetto romagnolo« bzw. wird nur noch als exotische Erscheinung künstlich am Leben erhalten. Die jungen Generationen auf dem Land erleben Traditionen oft als eine Art »Vorbelastung« im modernen Wettbewerb und haben wenig Interesse, die Bauernhöfe der eigenen Eltern zu übernehmen. Sie ziehen lieber in die Stadt, den Inbegriff der Moderne. Wie konnte die Kultur der Modernisierung sich so schnell verbreiten und erfolgreich durchsetzen – und jahrhundertalte lokale Kulturen überrollen?
Ein wesentliches Merkmal des Kulturprogramms der Modernisierung ist ihr Universalanspruch und die Abwertung jeder Alternative (als rückständig, wachstums- und entwicklungshemmend usw.). Deshalb ist sie Inbegriff der »Monokultur«. Ihre Dominanz basiert aber weniger auf einer inhaltlichen Überlegenheit, sondern auf einer medialen im umfassenden Sinne. Die Modernisierung beginnt durch eine »Kolonisierung der Imagination« und eine mentale (Um-)Programmierung (vgl. Hofstede/Hofstede 2009) – durch die Bildungsinstitutionen, die Massenmedien, die Marketingapparate und die Kulturindustrie. Gegen eine solche mediale Macht hatte die Generation meiner Großeltern keine Chance. Die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit bedarf einer Auseinandersetzung nicht nur mit dem Kulturprogramm der Modernisierung, sondern auch und vor allem mit der medialen Macht, die es weltweit trägt. Und wenn »das Medium selbst die Botschaft ist« (vgl. McLuhan 1967), benötigt Nachhaltigkeit nicht nur Kulturkritik, Gegenkulturen und Aufwertung lokalen Wissens, sondern auch andere Medien. Ein wichtiges Medium für Nachhaltigkeit liegt in der menschlichen und sozialen Kommunikation, zum Beispiel von Angesicht zu Angesicht oder als Gruppenerfahrung. Dabei ist der Mensch körperlich präsent und keine virtuelle, austauschbare Erscheinung. Die Stärke einer menschlichen Begegnung liegt in der Emotionalität, Verbindlichkeit und Vertrautheit, die daraus entstehen können. Während vor allem die mediale Wirklichkeit eine konstruierte ist und sich manipulativ ausdrücken kann, muss sich die menschliche Kommunikation viel stärker mit der unmittelbaren Realität messen und kann gleichzeitig auf sie direkt einwirken. Doch haben wir vielleicht in Zeiten des Zeitdrucks und der social communities genau solche Formen von Kommunikation verlernt? Wenn es so ist, dann sind gerade Projekte wie der Tag des guten Lebens umso wichtiger, denn sie können auch zur »Schulung« der menschlichen und sozialen Kommunikation dienen – und durch entsprechende Kompetenzen gestützt werden.
Zweitens. Die Generation meiner Eltern hat die große Relevanz von Emanzipation und sozialer Frage begriffen und zog sich doch ab den 1980ern mehr und mehr ins Private zurück, wobei ihr Engagement nachließ. Diese Entpolitisierung der Gesellschaft hatte nicht nur endogene Ursachen. Nach den studentischen Protesten der 1968er Jahre wurde in Italien als Reaktion die sogenannte »Strategie der Spannung« verfolgt. Zahlreiche Politiker und engagierte Richter wurden ermordet, Bomben wurden in Zügen gelegt, alleine der Anschlag am Hauptbahnhof Bologna am 2. August 1980 forderte 85 Opfer, der Terrorismus erschütterte das Land. Selbst bei Friedensdemonstrationen gab es eine massive Polizeipräsenz und oft schlugen die Sicherheitskräfte hart auf die Demonstranten ein. Die häufige Verbindung mit Gewalt hat zu einer massiven Abwertung von politischen Alternativen und politischem Widerstand geführt. In den letzten Jahrzehnten haben immer mehr Menschen den Eindruck bekommen, die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung nicht wirklich mitbestimmen zu dürfen. Der Konsumismus und die leichte Unterhaltung des Privatfernsehens waren ab Mitte der 1980er auch eine Art Kompensation für die politische Resignation, die um sich griff. Selbst in der heutigen Nachhaltigkeitsdebatte nimmt man die Menschen oft eher als Verbraucher denn als Bürger wahr. Die Entpolitisierung ist aber auch die Konsequenz einer progressiven Uniformierung der Parteilandschaft:
»Die Linken [haben] es nicht geschafft, eine Alternative zu entwickeln […] Die Rechtspopulisten sind in den Ländern Westeuropas am stärksten, in denen sich die ehemals starken, sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien dem Markt untergeordnet und dadurch ihre Fähigkeit, die Interessen der Schwachen zu vertreten, in vielen Bereichen aufgegeben haben. Die politische Entfremdung kommt aber auch von unten, weil alle Vektoren des Lebens auf das Individuum zugeschnitten sind: Die Individualisierung trägt in sich die Idee, dass meine Herkunft nicht mehr über meinen Lebensweg bestimmt. Aber ich fühle mich dadurch auch nicht mehr als Teil der Arbeiterschicht im Sinne einer lebensweltlichen politischen Gemeinschaft: Das gemeinsame Feiern, die gemeinsamen Vereine, Genossenschaften, was sehr stark durch die Sozialdemokratie tradiert wurde, verschwinden – und damit auch das Milieu, auf das sich linke Parteien stützen können«. (Nachtwey 2016)
Immer mehr Menschen finden sich in den Parlamenten nicht mehr vertreten und bleiben so den Wahlurnen fern. Die institutionalisierte Politik verkommt mehr und mehr zu einer Form der Verwaltung – und dies gilt vor allem in Zeiten leerer Kassen. Es stellt sich so die Frage, wo Politik im eigentlichen Sinne noch stattfinden kann. Die Grundidee des Tags des guten Lebens in Köln ist, Räume der gelebten Demokratie in der Stadt zu schaffen. Solche Räume befinden sich auch in Universitäten oder Theatern; auch sie sind Orte, in denen andere Formen der Politik entwickelt und praktiziert werden bzw. werden können.
Die Generation meiner Eltern wollte sich emanzipieren, aber dies hat nicht zu einem höheren Grad an Selbstbestimmung geführt, weil alte Abhängigkeiten durch neue ersetzt worden sind. In der modernen Gesellschaft nimmt die Selbstversorgung ab und die Abhängigkeit von der Fremdversorgung zu. Um Bedürfnisse zu befriedigen, braucht es Geld. Wer für 30 bis 50 Stunden pro Woche auf Selbstbestimmung verzichtet und sich einem Arbeitgeber unterordnet, bekommt einen Lohn. Damit können nicht nur Grundbedürfnisse befriedigt, sondern auch Freizeit erkauft und bespielt werden. Doch die moderne Freizeit ist oft so frei wie die Auswahl im Regal eines Supermarkts und das Spektrum der Urlaubsziele. Die Vermehrung der Bedürfnisse durch die Werbemaschinerie und die zunehmende Monetarisierung sozialer Verhältnisse hat die Abhängigkeit der Menschen von der Erwerbsarbeit weiter erhöht. Schließlich hat der Abbau des Sozialstaates und die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse zu einer verbreiteten Angst vor dem sozialen Abstieg geführt. Diese Angst macht Menschen noch unterwürfiger, sie geben ihr Engagement für mehr Gerechtigkeit auf, um noch mehr in den sozioökonomischen Wettbewerb investieren zu können.
Eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit muss die Menschen aus diesem Teufelskreis befreien. Der Weg zur Emanzipation führt über eine Demonetarisierung, Entkommerzialisierung und Dematerialisierung der sozialen Verhältnisse. Es geht nicht nur um andere Arbeitsformen, sondern auch um den Ausbau des Gemeinwesens und um die Entwicklung von weltoffenen Kooperations- und Gemeinschaftsformen: Die alte geschlossene, uniforme Dorfgemeinschaft bot zwar eine hohe soziale Sicherheit, aber wenig Freiheit.
Drittens. Das Versprechen der neoliberalen Globalisierung war, dass die Weltgesellschaft stärker zusammenrückt, wenn die Märkte liberalisiert werden und der Wirtschaftshandel zwischen den Ländern erleichtert wird. Doch genau das Gegenteil ist eingetreten.[4] »Es wurden noch nie so viele [sichtbare und unsichtbare] Mauern gebaut, wie nach dem Fall der Berliner Mauer«, sagt der italienische Philosoph Roberto Esposito.[5] Die Kluft zwischen Reichen und Armen, die anomischen Erscheinungen (Korruption, Steuerhinterziehung, organisierte Kriminalität, Fremdenfeindlichkeit, Amokläufe u. a.), die Polarisierungen und die internationalen Krisenherde nehmen zu.
Während die Profite zum großen Teil privatisiert werden, wurden die Kosten der Finanzkrise von 2007/2008 durch die staatliche Bankenrettung und den Verlust an Zusammenhalt in der Weltgesellschaft sozialisiert. Trotzdem traut sich heute fast keine Regierung an die Ursachen dieser Krise heran. Eine echte Regulierung der Finanzmärkte hat bisher nicht stattgefunden. An der Durchsetzung von Handelsabkommen wie TTIP und CETA scheint die Europäische Union deutlich mehr Interesse zu haben als an der Einführung einer Transaktionssteuer. Die Institutionen, die Verträge und die Interessen, die die neoliberale Globalisierung durchgesetzt haben und tragen, können eine ganze Demokratie aufheben – in den letzten Jahren war der Fall Griechenland dafür eine bittere Lehre. Auch wenn soziale Bewegungen Korrekturen erreichen können, so kann sich diese Weltordnung nur selbst wirklich gefährden. Deshalb muss eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit genau dort ansetzen, wo noch Spielräume für den gesellschaftlichen Wandel vorhanden sind, nämlich im Lokalen. In der Hierarchie der Institutionen sind die Regionen, die Kommunen und die Bezirksvertretungen das schwächste Glied, aber gerade deswegen potentielle Partner eines Veränderungsprozesses, da sie den Bürger/innen am nächsten stehen und von diesen leichter beeinflusst werden können.
»Die Finanzkrise war eine Vertrauenskrise«[6] – und die Frage ist, wo das Vertrauen, das eine Neugründung der Demokratie und des Marktes voraussetzt, gefördert werden kann. Eine zentrale These dieses Buches ist, dass Vertrauen vor allem dort wieder entstehen kann, wo Menschen sich im Alltag persönlich begegnen und begegnen können, nämlich im Lokalen. Der lokale Transformationsansatz darf jedoch nicht zu einer Reproduktion oder gar Verschärfung der sozialen Ungleichheit führen, wobei wohlhabende Viertel der Stadt das »gute Leben« pflegen, während ärmere Viertel weiter abgehängt werden.[7] »Die Beziehungen zwischen unabhängigen und autonom tätigen Gemeinschaften müssen irgendwie begründet und geregelt werden« (Harvey 2013: 154). Es wird eine übergeordnete Vernetzung zwischen ihnen benötigt, die gemeinsame Regeln sowie Mechanismen der gerechten Umverteilung auf einer höheren Ebene beschließt, durchsetzt und kontrolliert und das lokale Handeln mit einer globalen Verantwortung und Bewegung verbindet.
Für viele Jahre war Internationalität auch im Wissenschaftsbereich ein Statussymbol, während fast keine Universität die eigene Stadt als Wirkungsgebiet und wichtigen Partner wahrgenommen hat. Auch in der Nachhaltigkeitsdebatte klang »lokal« wie »provinziell«, während Transformation vor allem mit internationalen Konferenzen verbunden wurde. So sind die Wissenschaft und die Nachhaltigkeitsdebatte heute oft weit weg vom Alltag der Menschen. Die Erfahrung hat gezeigt, wie trügerisch die Überzeugung war, dass ein Wandel auf dieser Art und Weise stattfinden könne. Es ist Zeit, aus diesen Lehren zu lernen und andere Wege der Transformation zu gehen.
Seit 1992 lebe ich in Deutschland. Damals gab es in Italien noch Menschen, die mich vorwurfsvoll fragten: »Wie kannst du nur in einem solchen Land leben, das so viel Unglück gebracht und solche Massaker bei uns angerichtet hat?« Und doch war gerade das für mich ein Grund, um nach Deutschland zu kommen. Ich wollte verstehen, wie ausgerechnet die Heimat großer Philosophen, die mich im Studium derart faszinierten, für Auschwitz verantwortlich sein konnte. Ich wollte verstehen, was Fortschritt und Untergang miteinander zu tun haben.
Der zweite Grund: Italien erlebte ich damals als ein sehr katholisches, familienzentriertes und konservatives Land. Ich sehnte mich nach offeneren sozialen Strukturen, nach einer weltoffenen Familie und Gemeinschaft – und verband diese Möglichkeit mit dem aufgeklärten Nordeuropa. Inzwischen pflege ich ein differenzierteres Bild dieser Gesellschaft und lebe in einer relativ vielfältigen Stadt wie Köln. Wie in Italien habe ich mein Leben auch in Deutschland an einer Maxime ausrichten wollen: Wenn ich etwas vermisse oder mich danach sehne, dann kann ich es selbst gestalten und schaffen, und zwar am besten mit anderen gemeinsam. Die gesellschaftliche Entwicklung ist nämlich kein Schicksal. Wir können unsere eigene Stadt und unsere Region ändern, wir können sie so ändern, dass wir zum Beispiel am liebsten darin Urlaub machen.
Lange Zeit war ich in diesem Land vor allem ein »Mensch mit Migrationshintergrund« und meine exotische Herkunft (»bella Italia!«) erleichterte mein Leben hier nicht unbedingt, im Gegenteil. Migranten bilden aber eine große Ressource für eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, weil keine Normalität für sie selbstverständlich ist, sie stets den Fremdblick pflegen und als Grenzgänger Botschafter anderer Realitäten sind. Migranten, die eine Emanzipation jenseits der Modernisierung verfolgen, sind potentielle Change Agents. Solch ein Migrant steckt in jedem von uns.
© Aus: Davide Brocchi (2017), Urbane Transformation. Zum guten Leben in der eigenen Stadt. Herausgegeben von den Urbanisten, Dortmund. Bad Homburg: VAS. S. 23-42.
Literatur
- B.U.N.D.; EED; Brot für die Welt (Hrsg.) (2008): Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung
- Commoner, Barry (1973): Wachstumswahn und Umweltkrise. München/Gütersloh: Bertelsmann. (Im Original: The Closing Circle. 1971)
- Gorbatschow, Michail (1987): Perestroika. Die zweite russische Revolution. Eine neue Politik für Europa. München: Droemer Knaur Verlag
- Harvey, David (2013): Rebellische Städte. Berlin: Suhrkamp
- Hofstede, Geert; Hofstede, Gert Jan (2009): Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. München: dtv
- McLuhan, Marshall (1967): The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. New York: Random House
- Nachtwey, Oliver (2016): Gesellschaftskritik: »Lauter kleine Narzissten, auf Wettbewerb getrimmt«, ein Interview von Eva Thöne. In: Spiegel-Online, 14.08.2016
- Weisäcker, Ernst Ulrich von, et al. (2010): Faktor Fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum. München: Droemer
Fußnoten
[1] »Bereits seit geraumer Zeit befindet sich das fossile ökonomische System international im Umbruch. Dieser Strukturwandel wird vom WBGU als Beginn einer ‚Großen Transformation‘ zur nachhaltigen Gesellschaft verstanden, die innerhalb der planetarischen Leitplanken der Nachhaltigkeit verlaufen muss […] Es geht um einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine klimaverträgliche und nachhaltige Weltwirtschaftsordnung« (WBGU 2011: 1f.).
[2] Diese Erinnerung ist zum Teil wissenschaftlich belegt: »Trotz des enorm gestiegenen Pestizideinsatzes [bewegt sich] der Anteil der Ernte, der durch Schädlingsbefall verloren geht, mit rund 35 Prozent immer noch auf dem Niveau des Zweiten Weltkriegs« (Costanza/Cumberland et al. 2001: 78f.).
[3] In der Nachkriegszeit die größte kommunistische Partei in Westeuropa, die bei Wahlen in den 1970ern Spitzenwerte von 35 Prozent erreichte.
[4] Diese Entwicklung hat vieles gemeinsam, mit der, die der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Karl Polanyi in »The Great Transformation« 1944 beschrieb. Die Liberalisierung der internationalen Märkte führte 1929 zur großen Finanzkrise und diese später letztendlich zum Weltkrieg.
[5] Vortrag am 20. Mai 2011 im Italienischen Kulturinstitut, Köln.
[6] Rede des Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes Heinrich Haasis anlässlich der 56. Kreditpolitischen Tagung der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen am 5. November 2010 in Frankfurt/Main.
[7] Dezentralisierung und Autonomie können grundlegende Mittel zur Erzeugung größerer Ungleichheit durch Neoliberalisierung sein (Harvey 2013: 153).








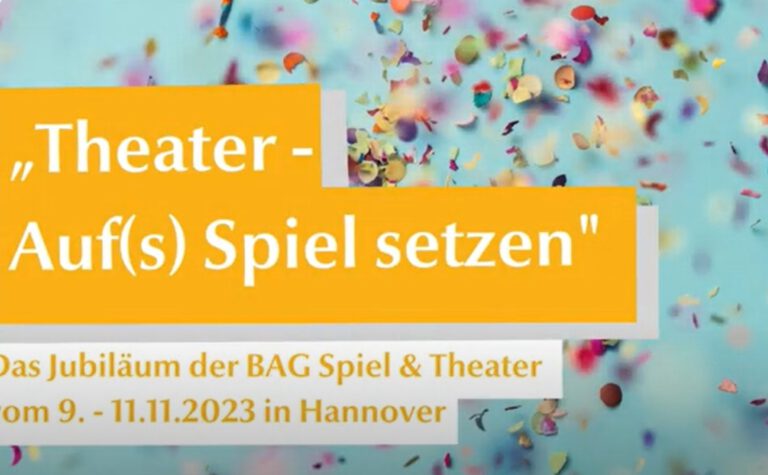

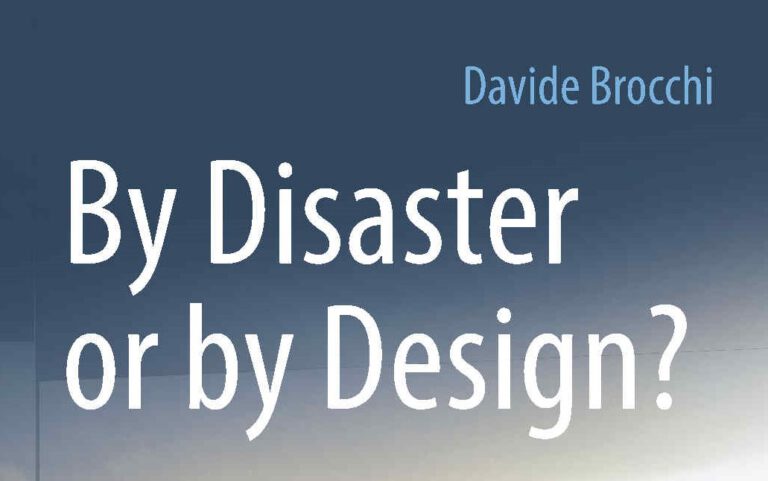


Neueste Kommentare